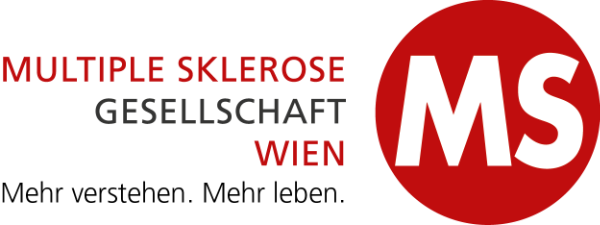Unsere Kolumnistin Anja Krystyn gibt regelmäßig Einblick in ihren Alltag mit MS. Sie berichtet über psychische, physische und emotionale Hürden und Freuden mit der Krankheit der 1.000 Gesichter.
Schönes Kompliment
Seit ich krank bin, melden sich etliche alte Bekannte nicht mehr bei mir. Umso mehr überraschte mich kürzlich der Anruf meines früheren Schulkollegen Roland. Zuletzt hatten wir uns beim Klassentreffen vor fünf Jahren gesehen. Außer meiner Diagnose weiß er nichts von mir.
„Entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde.“, begrüßt er mich am Telefon. „Ich habe oft an dich gedacht, kommst du zurecht?“ Ich erwidere kurz, dass alles okay sei. „Wir müssen uns unbedingt einmal treffen.“, schlägt er zu meiner Verwunderung vor. „Ich kann dich gern besuchen, was hältst du vom nächsten Samstag?“ Etwas überrumpelt stimme ich zu.
Als er wenige Tage später mit einem Blumenstrauß vor meiner Tür steht, bin ich gerührt. Vermutlich haben gemeinsame Bekannte ihm erzählt, dass ich inzwischen im Rollstuhl sitze. Ob er aus schlechtem Gewissen oder Mitleid kommt, ist mir in diesem Moment egal. Gleich beim Hereinkommen sieht er mich bewundernd an. „Du siehst toll aus, hast dich überhaupt nicht verändert.“, meint er mit einem Küsschen auf meine Wange. „Haha.“, weise ich auf meinen Rollstuhl. „Trotzdem danke für das Kompliment.“
Die folgende Stunde verbringen wir mit Kaffeetrinken, Kuchenessen und Gelächter über Fotos aus der Schulzeit. Mit keinem Wort sprechen wir über sein oder mein Leben der letzten Jahre. Vermutlich stellt er mir aus Taktgefühl keine Fragen über die Krankheit. Schließlich packt mich die Neugier. „Jetzt sag mir endlich, was du jetzt so treibst!“, rufe ich. Als hätte er auf mein Stichwort gewartet, beginnt er von seiner Arbeit als erfolgreicher Unternehmensberater zu erzählen. Seit kurzem biete er als Coach Beratung in schwierigen Lebenssituationen an. „Ich arbeite mit einem ganz neuen Ansatz, nur für Anspruchsvolle.“, schwärmt er. Aus seiner Aktentasche holt er Skizzen seines Projekts, die er auf dem Couchtisch vor mir ausbreitet. Ich nicke interessiert, obwohl meine schlechten Augen kaum etwas erkennen. „Das wäre bestimmt etwas für dich.“, verkündet er. „Du hättest das Privileg, unter meinen ersten Schülerinnen zu sein.“
Ich starre ihn verständnislos an. Privileg wofür? Durch meinen Kopf schießt sein Anruf, sein Wunsch, mich nach langem wiederzusehen, sein Kompliment über mein Aussehen. War das Strategie, um mich als krisengebeutelte Kundin anzuwerben? Unwillkürlich drehe ich meinen Kopf von ihm weg, um die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken. Er bemerkt sie und räumt rasch seine Skizzen in die Tasche zurück. „Versteh mich bitte nicht falsch.“, sagt er. „Ich finde es toll, wie du mit deiner Situation umgehst.“
Jetzt laufen meine Tränendrüsen über. Ich drücke die Lenkstange meines Rollstuhls, der einen Sprung zum Fenster macht. „Welche Situation meinst du?“, frage ich mit abgewandtem Gesicht. „Naja, wie du das alles meisterst.“, stottert er. Solche distanzierten Floskeln kenne ich von Leuten, die nichts über mich wissen.
Schlagartig vergeht mir die Lust auf das Gespräch mit meinem Schulkollegen. Ich sei müde, sage ich und bedanke mich nochmals für die Blumen. Als er ohne weitere Fragen meine Wohnung verlässt, bin ich traurig, aber klüger.
Anja Krystyn
Unsere Kolumnistin Anja Krystyn gibt regelmäßig Einblick in ihren Alltag mit MS. Sie berichtet über psychische, physische und emotionale Hürden und Freuden mit der Krankheit der 1.000 Gesichter.